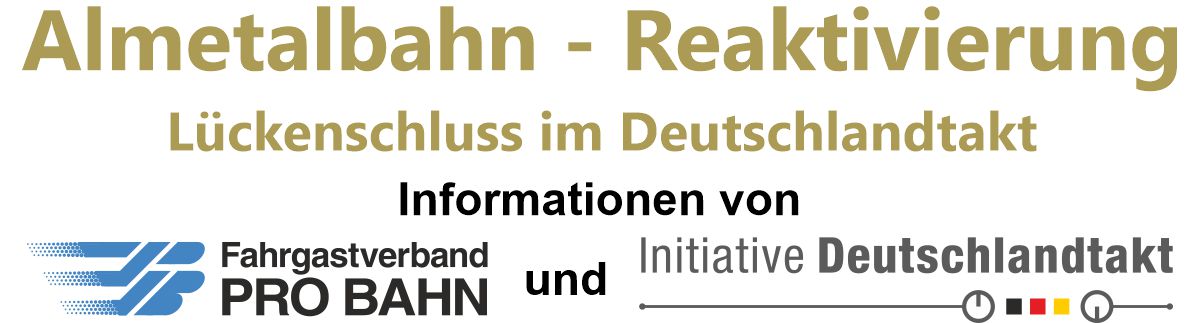Moderne Regionalbahnen auf einer reaktivierten Almetalbahn fahren elektrisch, auch wenn keine Oberleitung vorhanden ist. Die Energie kommt aus Batterien oder wird durch Wasserstoff-Brennstoffzellen an Bord erzeugt. Beide Fahrzeugtypen sind leise und lokal emissionsfrei und können – anders als Dieseltriebwagen Bremsenergie wieder zurückspeisen. Hinsichtlich der Geräuschentwicklung sind beide Fahrzeugtypen gleichwertig und leiser als Dieseltriebwagen.
Allgemeine Anforderungen an Regionaltriebwagen
Abgesehen von der Antriebstechnologie (siehe unten) sind die Anforderungen an Regionaltriebwagen hoch. Barrierefreiheit ist selbstverständlich. Mehrzweckräume für die Mitnahme von Rollstühlen und Fahrrädern sind Standard, Klimaanlagen sind selbstverständlich. Die Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs, für die Almetalbahn der NWL, bestimmen über Ausschreibungen weitgehend, wie die Fahrzeuge zu gestalten sind. Vorgaben dazu sind im Nahverkehrsplan festgelegt.
Antrieb: Stand der Entwicklung
Die Beschaffung von Regionalbahn-Triebwagen für nicht elektrifizierte Strecken befindet sich im Umbruch.
Dieseltriebwagen: Technik von gestern

Dieseltriebwagen werden nur noch beschafft, wenn sie sehr kurzfristig verfügbar sein müssen. Daher bieten immer weniger Hersteller Dieseltriebwagen an.
Für das sog. Sauerland-Netz (dazu gehört auch die Verbindung Bestwig – Brilon Stadt) sind neue Dieseltriebwagen des Typs „Pesa Link“ beschafft worden.
Zu dem Zeitpunkt, als der Kauf ausgeschrieben wurde, waren noch keine Fahrzeuge der neuen Technik-Generation verfügbar. Die „Pesa Link“ waren anfangs sehr störanfällig und wurden daher häufig durch ältere Fahrzeuge ersetzt. Unter anderem gehört zu den älteren Fahrzeugen die Baureihe 644, die schon elektrische Motoren hat. Der Strom wird aber durch laute Diesel-Generatoren erzeugt. Auch das ist nicht mehr Stand der Technik.
Foto: Pesa Link im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. ©Pesa
Elektrotriebwagen mit Batterien auf der Erfolgsspur
 Mehrere Unternehmen bieten bereits Fahrzeuge an, die aus elektrischen Triebwagen für Oberleitungsbetrieb entwickelt werden, aber Batterien mitführen. Wo keine Oberleitung zur Verfügung steht, können diese Fahrzeuge zwischen 40 und 80 km (laut Angabe der Hersteller) ohne Oberleitung zurücklegen. Wird diese Reichweite überschritten, muss eine Lademöglichkeit erreicht werden, in der Regel eine Oberleitung des elektrifizierten Netzes. Die erste Bauserie von 55 Fahrzeugen eines solchen Fahrzeugtyps ist bereits in Schleswig-Holstein im Einsatz. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) strebt die Beschaffung solcher Fahrzeuge bereits für die Neuvergabe der diese Netze in Ostwestfalen-Lippe an. Zu diesem Netz gehört auch die Sennebahn Bielefeld – Paderborn.
Mehrere Unternehmen bieten bereits Fahrzeuge an, die aus elektrischen Triebwagen für Oberleitungsbetrieb entwickelt werden, aber Batterien mitführen. Wo keine Oberleitung zur Verfügung steht, können diese Fahrzeuge zwischen 40 und 80 km (laut Angabe der Hersteller) ohne Oberleitung zurücklegen. Wird diese Reichweite überschritten, muss eine Lademöglichkeit erreicht werden, in der Regel eine Oberleitung des elektrifizierten Netzes. Die erste Bauserie von 55 Fahrzeugen eines solchen Fahrzeugtyps ist bereits in Schleswig-Holstein im Einsatz. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) strebt die Beschaffung solcher Fahrzeuge bereits für die Neuvergabe der diese Netze in Ostwestfalen-Lippe an. Zu diesem Netz gehört auch die Sennebahn Bielefeld – Paderborn.
Auch für das Sauerland-Netz verfolgt der NWL den Einsatz Batterie-elektrischer Fahrzeuge, sodass einzelne Streckenabschnitte mit Oberleitung ausgestattet werden sollen.
Foto: Flirt Akku, Kiel-Oppendorf März 2024. Das Foto darf mit der Autorenangabe „Engel“ für Pressezwecke verwenden.
Triebwagen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen: Ernüchterung nach Euphorie
 Weltweit erstmals hat das Unternehmen Alstom mit Sitz in Salzgitter in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen zwei Prototypen eines Triebwagens gebaut (Produktbezeichnung „iLint”), der einem herkömmlichen Dieseltriebwagen gleicht, aber mit elektrischen Fahrmotoren ausgerüstet ist. Die Energie wird bei diesen Fahrzeugen von Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugt und über eine Pufferbatterie für die Energieversorgung der Fahrmotoren bereitgestellt.Nach der Testphase wurde eine Serie dieser Fahrzeuge gebaut und ist im Raum Bremervörde und Frankfurt im Einsatz.
Weltweit erstmals hat das Unternehmen Alstom mit Sitz in Salzgitter in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen zwei Prototypen eines Triebwagens gebaut (Produktbezeichnung „iLint”), der einem herkömmlichen Dieseltriebwagen gleicht, aber mit elektrischen Fahrmotoren ausgerüstet ist. Die Energie wird bei diesen Fahrzeugen von Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugt und über eine Pufferbatterie für die Energieversorgung der Fahrmotoren bereitgestellt.Nach der Testphase wurde eine Serie dieser Fahrzeuge gebaut und ist im Raum Bremervörde und Frankfurt im Einsatz.
Der für die Energieversorgung notwendige Wasserstoff kann grundsätzlich aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, indem insbesondere überschüssiger Strom aus Wind- und Solarenergie zur Herstellung des Wasserstoffs eingesetzt wird. Diese Technologie befindet sich in der Entwicklung. Bis insoweit genügende Mengen zu wirtschaftlichen Preisen verfügbar sind, wird sogenannter grauer Wasserstoff eingesetzt, der in der chemischen Industrie als Nebenprodukt anfällt.
Die für die Wasserstofftankstellen notwendige Infrastruktur gilt grundsätzlich als sicher.
Der Vorteil der Wasserstofftechnologie ist die deutlich größere Reichweite der Fahrzeuge, die mit Werten zwischen 600 und 1000 km angegeben wird.
Alstom „iLint“ im Fahrgastbetrieb, abfahrbereit in Buxtehude.
Als nachteilig wird die mangelhafte Effizienz und Wirtschaftlichkeit angesehen. Während erzeugter Strom am Rad eines Triebwagens mit Oberleitung zu 90 % wirksam wird, wird er auf dem Umweg über die Wasserstoff-Brennstoffzelle zu weniger als einem Drittel wirksam. Um den Wasserstoff konkurriert auch die Industrie, die ihn für thermische Prozesse statt Gas und Kohle einsetzen möchte. Mangels Oberleitung ist Wasserstoff auch für Lkw von großem Interesse. Der Wasserstoff-Triebwagen könnte zwar unter Oberleitung direkt Strom verwenden, aber dadurch wird die Technologie teurer und schwerer. Daher sind die Fahrzeuge in Deutschland wenig interessant.
Elektrobus ist keine bessere Alternative
Auch bei den Bussen ist die Entwicklung vergleichbarer Technologien in vollem Gange. Am weitesten ist die Entwicklung für städtische Buslinien. Hier ist der Elektrobus mit Batterien die erste Wahl, da die Wege zu Ladeeinrichtungen kurz sind. Für regionale Buslinien müssen entsprechende Konzepte sowohl hinsichtlich der Fahrzeuge wie hinsichtlich der Energieversorgung erst entwickelt werden.
Gegenüber den Bussen haben Regionalbahn-Triebwagen den Vorteil, dass das zusätzliche Gewicht von Batterien und Wasserstoff-Tanks wenig Bedeutung hat, da die Höchstlast der Schienen nicht erreicht wird und Aggregate auch auf dem Dach angebracht werden können. Busse als Straßenfahrzeuge sind hingegen auf Leichtbau ausgelegt, sodass zusätzliches Gewicht von Batterien und anderer Technik in Konkurrenz zur Fahrgastkapazität tritt. Noch sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Umstellung auf lokal emissionsfreie Busse nicht ausreichend abschätzbar. Zu beachten ist, dass Betriebshöfe für elektrische Busse einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz erfordern, der erhebliche zusätzliche Investitionen erfordern k
Stand: April 2024
Triebwagen mit Wasserstoff-Brennstoffzel